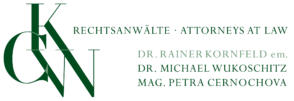Archiv
Kreuzfahrtveranstalter haftet nicht für Campylobacter-Infektion
Eine Reisende erkrankte am 10. Tag einer zweiwöchigen Karibik-Kreuzfahrt im Februar 2020 an einer Magen/Darm-Infektion, ausgelöst durch den Erreger Campylobacter. Das Erstgericht stellte fest, dass es im Reisezeitraum zu keiner Häufung solcher Infektionen an Bord gekommen war und im Bereich der Verpflegung alle Hygieneregeln beachtet wurden. Campylobacter-Infektionen sind bei Menschen meist lebensmittelassoziiert und das Erstgericht erachtete eine Ansteckung der Reisenden auf dem Kreuzfahrtschiff als durchaus wahrscheinlich.
Das Erstgericht sprach für die Beeinträchtigung der Kreuzfahrt durch die Infektion Preisminderung, Schmerzengeld und Ersatz entgangener Urlaubsfreude zu. Das Handelsgericht Wien gab der Berufung des Kreuzfahrtsveranstalters Folge: Zum einen sei das Regelbeweismaß der ZPO die hohe Wahrscheinlichkeit, sodass aufgrund der vom Erstgericht festgestellten bloß einfachen Wahrscheinlichkeit schon der Kausalitätsbeweis nicht erbracht sei. Zum anderen sie die Haftung des Kreuzfahrtveranstalters nach Art 3 des Athener Übereinkommens 2002 zu prüfen und erfordere daher (mangels eines schadensauslösenden Schiffahrtsereignisses) ein vom Kläger nachzuweisendes Verschulden, an dem es aufgrund der festgestellten Einhaltung aller Hygieneregeln fehle (HG Wien 17.02.2022, 60 R 136/21m).
Obwohl der Kreuzfahrt-Markt in den letzten Jahren (zumindest vor Corona) einen regelrechten Boom erlebt hat, sind Gerichtsentscheidungen zur Haftung für die Beförderung von Reisenden auf See nach dem Athener Übereinkommen selten. Dass auch der Anspruch auf Preisminderung im Falle einer Erkrankung den Voraussetzungen und Einschränkungen des Athener Übereinkommens unterliegt, ist daher eine für die Branche wertvolle Klarstellung.
Neuer Gerichtsstand für Fluggast-Klagen
Klagen nach der „Fluggastrechte-VO“ (VO [EG] Nr. 261/2004) können nach dem 30. April 2022 in Österreich auch bei jenem Gericht eingebracht werden, in dessen Sprengel der Abflugs- oder Ankunftsort liegt (§ 101a JN). Gegenüber Luftfahrtunternehmen aus anderen EU-Staaten oder der Schweiz, Norwegen und Island galt dies aufgrund der Brüssel Ia-VO bzw. des LGVÜ und der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH (C-204/08 – Rehder; C-274/16 – flightright) schon bisher – nicht aber gegenüber Luftfahrtunternehmen aus Drittstaaten. Verfügte ein solcher Drittstaats-Carrier über kein Vermögen oder keine Vertretung in Österreich (§ 99 Abs 1 u. 3 JN), musste daher über den Umweg einer Ordination durch den OGH (§ 28 JN) ein zuständiges Gericht in Österreich bestimmt und dafür dargetan werden, dass die Rechtsverfolgung im Ausland nicht möglich oder unzumutbar wäre. Die Folge war eine große Zahl von Ordinationsanträgen, über die der OGH entscheiden musste.
Dieses Problem wird jetzt durch § 101a JN ‚behoben‘. Die Bestimmung ermöglicht darüber hinaus aber auch bei reinen Inlandsflügen eine Klagsführung am Abflugs- oder Ankunftsort. Nicht ganz verständlich ist hingegen, warum der neue Wahlgerichtsstand auf Ansprüche nach der Fluggastrechte-VO beschränkt wurde und nicht auch für Ansprüche nach dem Montrealer Übereinkommen oder vertragliche Ansprüche aus dem Luftbeföderungsvertrag gilt, bei denen sich eine ähnliche Problematik stellen kann. Insoweit erscheint § 101a JN trotz seiner unbestrittenen Vorteile für Fluggäste eher als ‚Anlass-Gesetzgebung‘ denn als Teil eines gesetzgeberischen Gesamtkonzepts für das Zuständigkeitsrecht.
Neuerungen im Urheberrecht
Mit 1. Jänner 2022 ist (zum Großteil) die Urheberrechtsnovelle 2021 in Kraft getreten, mit der die Richtlinien (EU) 2019/790 und 2019/789 umgesetzt werden. Die Rechte der Urheber werden ua bei Werken, für die ein Werknutzungsrecht gegen pauschale Vergütung eingeräumt wurde, durch ein Recht zur anderweitigen Verwertung nach Ablauf von 15 Jahren (§ 31a) gestärkt sowie auch durch neue Bestimmungen zur fairen Vergütung in Verwertungsverträgen mit Urhebern (§§ 37b ff). Erweist sich die vereinbarte Vergütung im Nachhinein als (gemessen an den aus der Verwertung erzielten Einnahmen) unverhältnismäßig niedrig, so besteht ein Anspruch auf zusätzliche Vergütung.
Änderungen gibt es auch bei den freien Werknutzung, wo nun etwa ausdrücklich die Nutzung veröffentlichter Werke für Karikaturen, Parodien oder Pastiches über große Online-Plattformen erlaubt (§ 42f) und das sog „Text- und Datamining“, also die automatisierte Auswertung von Texten und Daten für die wissenschaftliche oder künstlerische Forschung (§ 42h).
Verlegern wird ein Recht auf angemessene Beteiligung an den Vergütungsansprüchen jener Urheber eingeräumt, die dem Verleger Recht an ihren Werken eingeräumt haben (§ 57a) – jedoch kann eine solche Beteiligung vertraglich ausgeschlossen werden. Zudem werden die Hersteller von Presseveröffentlichungen gesondert geschützt (§ 76f).
Besonders kontrovers diskutiert worden war die Reglung von Schadenersatzansprüchen gegen Anbieter großer Online-Plattformen, die ihren Nutzern einen Upload von Werken ermöglichen. Die neuen Bestimmungen (§ 89a ff) versuchen, Urheber und Leistungsschutzberechtigte solcher Werke zu schützen, gleichzeitig aber auch die Interessen der Plattformnutzer zu wahren und insbesondere ein sog „Overblocking“ durch Plattformbetreiber zu verhindern.
Die Praxis wird zeigen, wie sich die neuen Reglungen bewähren.
Was „Verbraucher“ so verbrauchen
In einem Beitrag zu „Sprache und Recht“ in der jüngsten Ausgabe der ÖJZ widmet sich Michael Wukoschitz sprachlichen Betrachtungen zum Begriff des „Verbrauchers“, der in seiner Ursprungsbedeutung jemanden bezeichnet, der etwas „verbraucht“, also in einer substanzschädigenden Weise nutzt.
All zu oft verwendet man Begriffe, ohne sich über deren Herkunft und Bedeutung Gedanken zu machen, die – würde man sie denn anstellen – den Begriff in einem unerwarteten Licht erscheinen lassen könnten. Wie etwa eben jenen des „Verbrauchers“, der sich im Sprachgebrauch von seiner Ursprungsbedeutung so weit abgekoppelt zu haben scheint, dass er nicht mehr mit dem von ihm eigentlich umschriebenen Verhalten assoziiert wird, einem Verhalten, dem unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit kaum Positives abzugewinnen wäre. Kaum Positives mag unabhängig von sprachlichen Finessen auch so mancher Unternehmer empfinden, wenn er vom „Verbraucherschutz“ angegangen wird. Die Sprachspielereien sollen aber vor allem unterhalten. Wer sie (zu) ernst nimmt, hat vielleicht schon seinen Humor verbraucht.